
27.09.2018
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Ulm, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg (ZSW) sowie die Universität Gießen haben in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder erfolgreich das Exzellenzcluster „Energiespeicherung jenseits von Lithium – neue Speicherkonzepte für eine nachhaltige Zukunft“ eingeworben. Ein Teil der siebenjährigen Förderung von bis zu 10 Millionen Euro jährlich kommt dabei auch dem HIU als gemeinsamem Institut von KIT und der Universität Ulm zugute. Die Clusterentscheidung gaben die Bundesministerin für Bildung und Forschung und Vorsitzende der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK), Anja Karliczek, und die Bremer Wissenschaftssenatorin und stellvertretende GWK-Vorsitzende, Professorin Eva Quante-Brandt, am 27.09.2018, in Bonn bekannt.

Im Zentrum des bewilligten Exzellenzclusters steht die Forschung zu leistungsstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen Speichern für die Energiewende und die Elektromobilität. Die Forschenden werden ein fundamentales Verständnis der elektrochemischen Energiespeicherung in neuartigen Systemen erarbeiten, grundlegende Materialeigenschaften mit kritischen Leistungsparametern verbinden und so die Grundlagen für die kommerzielle Nutzung von Post-Lithium-Technologien schaffen. Bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien ist die maximale Speicherkapazität nahezu erreicht. Um Fortschritte in der Leistungsfähigkeit zu machen, muss auch die Entwicklung neuer, alternativer Speichermaterialien und Konzepte vorangetrieben werden. Für einen weiteren signifikanten Sprung bei der Energiedichte von Batteriezellen werden neue elektrochemische Paarungen benötigt. Aus diesem Grund suchen Elektrochemiker, Materialwissenschaftler und Modellierer im bewilligten Cluster nach alternativen Ladungsträgern – zum Beispiel auf Basis von Natrium, Magnesium, Aluminium oder Zink.
„Bereits im Vorfeld der Clusterentscheidung haben die beiden Standorte Ulm und Karlsruhe beschlossen, generell enger auf dem Gebiet der elektrochemischen Speicherung zu kooperieren: Die Forschenden haben gemeinsamen einen der weltweit größten Forschungsverbünde für Energiespeicherung namens CELEST, Center for Electrochemical Energy Storage, gegründet. Dank des Exzellenzclusters mit etwa 100 zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wächst das Konsortium für die Erforschung alternativer Speichertechnologien noch weiter“, erklärte Maximilian Fichtner, Direktor des HIU und Sprecher des Exzellenzclusters.
Mit der Exzellenzstrategie soll der Forschungsstandort Deutschland gestärkt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten gesteigert werden. Ab diesem Jahr stellen Bund und Länder 533 Millionen Euro pro Jahr für diese Ziele zur Verfügung. In der Förderlinie „Exzellenzcluster“ hatten 40 deutsche Universitäten 88 Anträge eingereicht, 57 davon hat die Exzellenzkommission nun zur Förderung ausgewählt. Insgesamt stehen für diese Förderlinie jährlich rund 385 Millionen Euro zur Verfügung. Exzellenzcluster können jährlich mit drei bis zehn Millionen Euro gefördert werden, dies zunächst für sieben Jahre. Förderbeginn ist der 1. Januar 2019. Ab 2026 ist eine zweite Förderperiode von wiederum sieben Jahren möglich.
27-28.09.2018
Maritim Hotel in Ulm, Germany
Magnesium batteries have attracted considerable attention by international research activities, because magnesium offers a number of attractive features for future batteries. The metal anode has nearly double the volumetric capacity of lithium metal, at a negative reduction potential of -2.37 Vs SHE. Moreover, a significant advantage of magnesium is the lack of dendrite formation during charging, which overcomes major safety challenges encountered with using lithium metal anodes. Several breakthroughs were achieved and important progress has been made in the last years, in particular in the development of electrolytes with mild chemistry and high efficiency and in the development of first conversion and intercalation-type cathodes. First fundamental studies have elucidated mechanisms of Mg intercalation or chemical interaction of the electrolyte with the electrodes.

The 2nd International Symposium on Magnesium Batteries addresses the research community in this rapidly growing field. It is the aim of the symposium to present and discuss the recent state-ofthe art and the progress in the field. There will be enough time for discussion of questions or controversial issues in the topic.
24.09.2018
Die Analyse des CO2-Fußabdrucks und der Lebenszykluskosten verschiedener Batterien für stationäre Anwendungen durch Forschende des HIU und des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), die in „Energy Technology“ erschien, wurde von der Zeitschrift als einer ihrer besten Artikel des Jahres 2017 ausgezeichnet.
Im Artikel CO2 Footprint and Life‐Cycle Costs of Electrochemical Energy Storage for Stationary Grid Applications (CO2-Fußabdruck und Lebenszykluskosten elektrochemischer Energiespeicherung für stationäre Netzanwendungen) werden die Lebenszykluskosten und Treibhausgasemissionen verschiedener Batterietechnologien in stationären Anwendungen ermittelt. Der Artikel ist ein Beitrag zur Sonderausgabe „Energy Research at Karlsruhe Institute of Technology“.
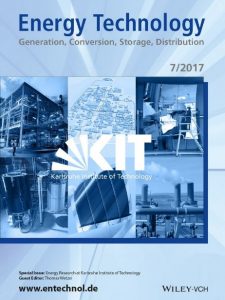
Die Autoren verwenden eine innovative Kombination aus Ökobilanzierung, Unsicherheitssimulation und Batteriegrößenoptimierung. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten wenden sie dynamische Lastprofile für die Optimierung der Größe und Lebensdauer von Batterien an und berücksichtigen den möglichen Einfluss zukünftiger Technologieentwicklungen wie Änderungen im Strommix oder sinkende Batteriepreise. Lithium-Ionen-Batterien gehören aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und vergleichsweise langen Lebensdauer zu den vielversprechendsten Batterietechnologien. Klassische Blei-Säure-Batterien sind zwar auf den ersten Blick billig, für stationäre Anwendungen aufgrund ihrer geringen Lebensdauer und Effizienz aber weniger empfehlenswert.
17.09.2018
Die HIU-Forschungsgruppe um Axel Groß hat es mit ihrer elementspezifischen Theorie – warum sich Batterie-Elektrodenmaterialien in ihrer Neigung zum Wachstum von Dendriten unterscheiden – auf das Backcover der Zeitschrift Energy & Environmental Science der Royal Society of Chemistry geschafft. Brennende Mobiltelefone oder in Flammen aufgehende Elektroautos gehen auf Dendritenbildung in Batterien zurück. Die Ergebnisse könnten helfen die Sicherheitsprobleme mit den strauchartigen Kristallstrukturen, die Kurzschlüsse verursachen können, zu lösen.
Die Forschenden suchten nach Batteriematerialien, die überhaupt keine Dendriten bilden. Während Lithium-, Zink- und Natriumbatterien häufig diese funkeninduzierenden Strukturen bilden, sind Magnesium- und Aluminiumbatterien nahezu dendritenfrei. Um die Dendritenbildung besser zu verstehen, suchten sie daher nach einem Zusammenhang zwischen den Selbstdiffusionsgrenzschichten verschiedener Metalle. Diese Grenzschichten sind die Schnittstellen, die die Diffusion eines Atoms auf einer Oberfläche aus dem gleichen Element reduzieren und bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich Metallatome auf Elektroden ablagern und Dendritenwachstum verursachen.

Durch die Untersuchung der verschiedenen Metalle fanden Axel Groß und sein Team heraus, dass Lithium-Ionen relativ hohe Selbstdiffusionsgrenzschichten aufweisen, was bedeutet, dass die Lithium-Ionen, sobald sie einen Gradienten auf eine Oberfläche diffundiert haben, dort verbleiben und eine raue Stelle bilden. Der Dendrit verzweigt sich dann von diesem Defekt. Dies deutet darauf hin, dass die Dendritenbildung eine inhärente Eigenschaft dieses Elements ist. Im Vergleich dazu haben Metalle wie Magnesium eine sehr geringe Selbstdiffusionsgrenzschicht und bilden glatte Oberflächen, so dass Dendriten weitaus seltener auftreten.
Die Theorie wurde zudem in Chemistry World in einer eigenen Meldung besprochen:
https://www.chemistryworld.com/news/diffusion-barrier-data-to-help-batteries-ditch-the-dendrites/3009502.article
Weitere Informationen finden Sie hier:
pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/EE/C8EE01448E
14.09.2018
Dagmar Oertel wird das HIU Mitte September verlassen, um sich als Generalsekretärin der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Seit 1. Januar 2012 war sie als Geschäftsführerin tätig und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass am HIU eine Infrastruktur geschaffen wurde, die die heute sehr zukunftsträchtige Forschung ermöglicht. Das Institut wurde 2011 in kürzester Zeit aus der Taufe gehoben und ist bis heute beachtlich gewachsen. Bei Dagmar Oertel liefen alle organisatorischen Fäden zusammen um diesen Prozess erfolgreich zu gestalten. So baute sie eine Administration mit 14 Mitarbeitenden in den Bereichen Personal, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, IT und Technik auf. Seit Beginn ihrer Tätigkeit koordinierte sie von HIU-Seite den Bau des neuen Institutsgebäudes, das im Oktober 2014 vom Land Baden-Württemberg mit einem Bauvolumen von 12 Millionen Euro und 2 400 Quadratmetern errichtetet wurde. In ihre Zeit als Geschäftsführerin fiel zudem die Einweihung der Solarstromspeicheranlage im Frühjahr 2015, die moderne Hochleistungsbatterien mit intelligenter Steuerung zur netzschonenden Einspeisung vereint.
Dagmar Oertel war als studierte Chemikerin und promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin mehr als zehn Jahre beim Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag tätig. 2007 wechselte sie nach Karlsruhe und begleitete den Gründungsprozess des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), wo sie ab 2009 im KIT-Präsidialstab stellvertretende Leiterin der Abteilung Strategie-, Struktur- und Entwicklungsplanung war.
06.08.2018
Der Artikel „Aqueous/Non-aqueous Hybrid Electrolyte for Sodium-ion Batteries “ gehört zu den meistgelesenen Artikeln des letzten Monats auf der Website des Journals ACS Energy Letters.
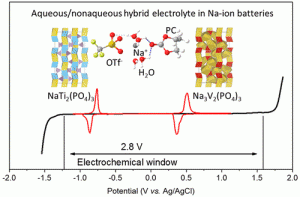
Das Forscherteam um Stefano Passerini berichtete von einem wässrigen/nichtwässrigen Hybrid-Elektrolyten auf Basis von Natriumtrifluormethansulfonat mit einem erweiterten elektrochemischen Fenster bis zu 2,8 V und hoher Leitfähigkeit (∼25 mS cm–1 bei 20 °C). Der Hybrid-Elektrolyt hat die Sicherheitscharakteristik wässriger Elektrolyte und die elektrochemische Stabilität nichtwässriger Systeme übernommen, was einen stabilen und reversiblen Betrieb der Natrium-Ionen-Batterie Na3V2(PO4)3/NaTi2(PO4)3 ermöglicht.
17.07.2018
Die Kick-off Veranstaltung von CELEST und die erste Mitgliederversammlung fand am HIU statt. Die CELEST-Mitglieder wählten die Sprecher der drei Forschungsbereiche, diskutierten aktiv gemeinsame Projekte und beschlossen zukünftige Aktivitäten und Strategien für die Forschungsplattform. Der CELEST-Lenkungsausschuss ernannte Prof. Maximilian Fichtner zum Direktor von CELEST und Prof. Helmut Ehrenberg zum stellvertretenden Direktor des Zentrums. Das Treffen legte den Grundstein für eine fruchtbare Zusammenarbeit und veranschaulichte eindrucksvoll das breite Spektrum der wissenschaftlichen Kompetenzen der CELEST-Mitglieder und ebnete den Weg für neue gemeinsame Anstrengungen im Bereich der elektrochemischen Energiespeicherung.
06.07.2018
Bei der zweitägigen Klausurtagung mit 120 Teilnehmenden präsentierten die Forschenden ihre Forschungsergebnisse der letzten beiden Jahre und diskutierten und beschlossen die Ausrichtung für die Zukunft. Der wissenschaftliche Austausch war zugeschnitten auf die vier HIU-Querschnittsthemen – Metallabscheidung und Grenzschichten, Insertionsmaterialien und Elektrodenstruktur, Lithiumbasierte Konversionsmaterialien und Legierungen, Neue Batterien jenseits Lithium. In jedem der vier Themen bündeln Mitglieder unterschiedlicher Forschungsgruppen auf diese Weise effizient ihre Kompetenzen.
Maximilian Fichtner und Stefano Passerini, Direktor und stellvertretender Direktor des HIU, hoben die zahlreichen in den letzten zwei Jahren neu geschlossenen internationalen Kooperationen sowie den mit zwei Veröffentlichungen pro Forschender pro Jahr sehr guten Publikationsschnitt hervor. Darüber hinaus stimmen die bisher erfolgreiche Bewerbung für die Exzellenzstrategie des Bundes sowie die Gründung der Batterieforschungsplattform CELEST optimistisch für die zukünftige Forschungsarbeit.
06.06.2018
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Universität Ulm (UUlm) und das Zentrum für Sonnenenergie-und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) weiten ihre Zusammenarbeit im Bereich der elektrochemischen Energiespeicherung weiter aus. Das am 1. Januar 2018 gegründete Zentrum für elektrochemische Energiespeicherung Ulm-Karlsruhe (CELEST) plant und organisiert neue gemeinsame Anstrengungen in Forschung, Lehre, Entwicklung und Technologietransfer. CELEST soll als Plattform dienen, um die Kommunikation zu verbessern und gemeinsame Aktivitäten mit anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie der Industrie im In- und Ausland zu koordinieren und weiterzuentwickeln. Mit den insgesamt 30 Instituten der drei Partner, die auf dem Gebiet Elektrochemische Energiespeicherung aktiv sind, stellt CELEST die größte Forschungsplattform zu dieser Thematik in Deutschland dar.

„CELEST stellt einen konsequenten weiteren Schritt dar, um die Standorte Ulm und Karlsruhe stärker zu vernetzen. Das HIU als gemeinsames Institut des KIT und der Universität Ulm bildet mit seiner Struktur eine Keimzelle dieses nun erweiterten Verbunds“, erklärt Maximilian Fichtner, Direktor des HIU.
Die Expertisen an beiden Standorten sind komplementär und reichen von der Grundlagenforschung auf der atomaren Skala bis zur größten Pilotanlage zur Zellfertigung in Deutschland. Die drei Partner-Institutionen werden interdisziplinär an Forschung und Entwicklung arbeiten, von der Grundlagenforschung über technische Anwendungen bis hin zur Qualifizierung von Studierenden.
„Mit den Schwerpunkten Li-Ionen-Technologie, Energiespeicherung jenseits Lithium und Alternative Techniken zur elektrochemischen Energiespeicherung bildet die Plattform alle hochaktuellen Themen in diesem Bereich ab, beim Thema Energiespeicherung jenseits Lithium nimmt CELEST eine nationale und internationale Spitzenstellung ein“, sagt Fichtner.
06.06.2018
ITAS, Karlstr. 11, 76133 Karlsruhe
Das Recycling gegenwärtiger Li-Ion Batterien ist aufwendig und zum Teil mit erheblichen Kosten und Umweltauswirkungen verbunden. Ferner können (je nach Recyclingtechnologie) auch nur ein Teil der Wertstoffe wiedergewonnen werden. Jedoch wird ein möglichst vollständiges Recycling aufgrund der Endlichkeit mineralischer Ressourcen und der teils hohen Umweltbelastung aus der Rohstoffgewinnung als zentral für eine positive Umweltbilanz von Batteriespeichern gesehen. Unabhängig davon werden gegenwärtig einige post-Lithium Speichersysteme entwickelt, über deren prinzipielle Rezyklierbarkeit noch sehr wenig bekannt ist. Soweit sich die Technologieentwicklung an der Verwendung kosten-günstiger Materialien orientiert, kann dies zu geringen wirtschaftlichen Anreizen für ein Recycling führen. Auf der anderen Seite gibt es emergente Batteriesysteme, die auf Reinmetall-Elektroden basieren, welche ein stoffliches Recycling nennenswert begünstigen.

Workshop und Expertenforum
Der eintägige Workshop bringt Experten aus verschiedenen Disziplinen und Institutionen wie Forschung, Industrie oder Politikberatung zusammen. Diese diskutieren unternehmerische Aspekte, Regularien, potentielle Umweltauswirkungen sowie die mögliche Anwendbarkeit gegenwärtiger und zukünftiger Recyclingverfahren auf die verschiedenen Batterie- und Zellchemien. Neben etablierten Li-Ionen Batterien werden dabei auch vielversprechende neue Zellchemien wie z.B. Li-Ion Festkörper, Na- Ion oder Mg-Ion Batterien betrachtet. Auf dieser Basis sollen dann erste Grundsätze für einen recycling-freundlicheren Aufbau von Batterien und potentielle Regeln für ein „design for recyclability“ im frühen Entwicklungsstadium entworfen werden.
Ziele