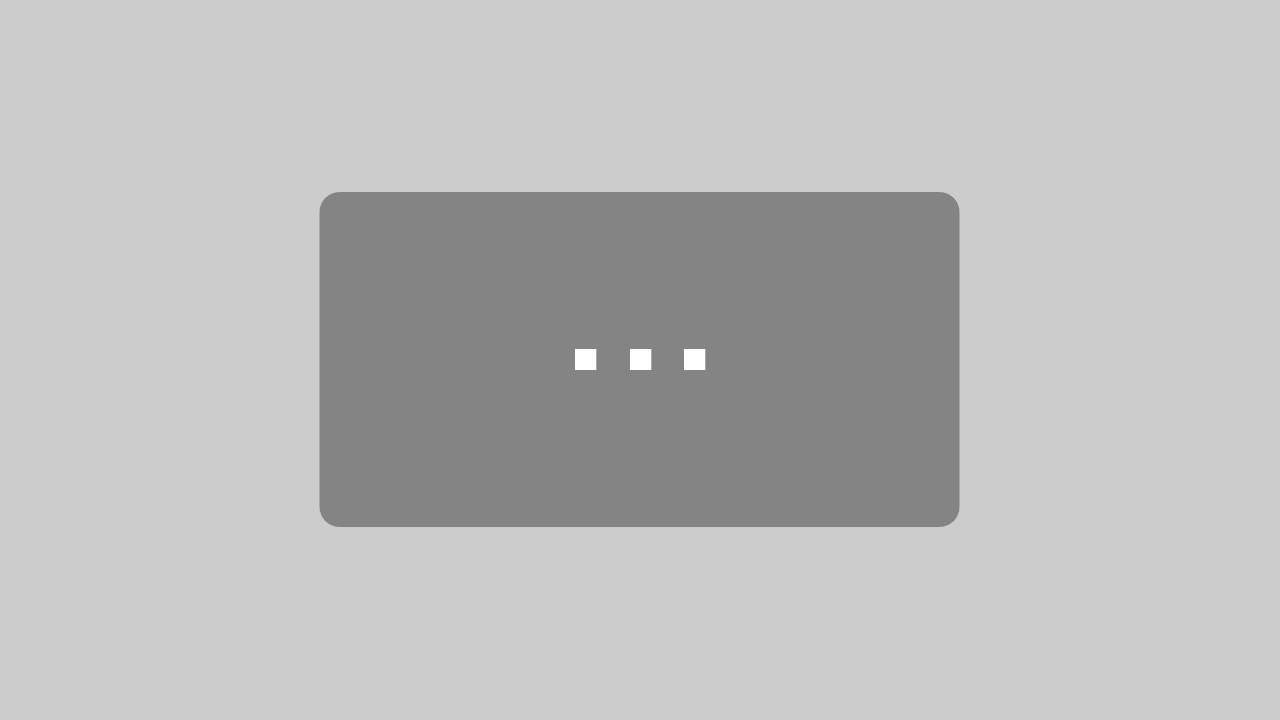
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
5. bis zum 08. Dezember 2022
Vom 5. bis zum 8. Dezember fand in Ulm die 7. ICNaB-Konferenz – die „Internationale Konferenz zu Natrium-Batterien“ statt. Die Veranstalter, das Helmholtz-Institut Ulm (HIU) und das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) begrüßten über 200 Forschende und zahlreiche Repräsentant*innen aus Wissenschaft, Industrie und Politik.
Today PhD student Arantzazu Letona from metal air research line presented at 7th ICNaB 2022 International #Conference on #Sodium #Batteries our work on Na air batteries! @HelmholtzUlm @energigune_brta @Ikerbasque great work! pic.twitter.com/ldMAYykIKZ
— Nagore Ortiz-Vitoriano (@nagore_o) December 8, 2022
Das Programm bestand aus 41 Vorträgen, der Präsentation von wissenschaftlichen Postern sowie der Auszeichnung derer. Das Organisatoren-Duo, bestehend Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens (ZSW) und Prof. Dr. Stefano Passerini (HIU), gab sich optimistisch: „Die ICNaB-Konferenz zeigte die vielen verschiedenen Aspekte von Natriumbatterien auf, die derzeit untersucht und entwickelt werden, um sie billiger, technologisch ausgereifter und vor allem nachhaltiger zu machen. Die Konferenz unterstrich das weltweite Industrie-Interesse an Natriumbatterien als Komplementärspeichern zu Lithium-Ionen-Batterien“, sagte Passerini.
Natrium-Ionen-Batterien stehen in Passerinis Forschungsgruppe im Vordergrund. Diese Zellen bestehen aus Materialien, die als verfügbar, unkritisch, besonders preiswert, leistungsstark und gleichzeitig langlebig beschrieben werden. Deshalb gelten diese Batterien auch als nachhaltig. Schon nächstes Jahr rechnet Passerini mit dem Hochfahren der Natriumbatterie-Produktion.
First speaker, Ingo Höllein from @BMBF_Bund, this morning at the 7th https://t.co/MZ7QJBymJJ – International #Conference on #Sodium #Batteries in Ulm. @KITKarlsruhe @uni_ulm @DLR_en @ulm_donau pic.twitter.com/lFMEKLmzds
— Helmholtz Institute Ulm ???? (@HelmholtzUlm) December 6, 2022
Die ICNaB-Konferenz in Ulm befasste sich auch mit dem Werdegang der Natriumbatterien vom Labor bis zur Massenproduktion. Dieser Übergang aus der Forschung bis hin zur industriellen Produktion bringt vielerlei Herausforderungen sowohl für Hochschulen als auch für Unternehmen mit sich: Von der Materialentwicklung, der Beschaffung, Einsatzorten bis hin zum Anlagenbau und Personalfragen. Darüber hinaus widmete sich die Konferenz notwendigen Infrastrukturinvestitionen sowie einer nachhaltigen Produktion und Wiederverwertung.
Darüber hinaus thematisierte die Konferenz auch die notwendigen Infrastrukturinvestitionen und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Produktion und eines nachhaltigen Recyclings. Eine wissenschaftliche-Poster Session gab Teilnehmern, vor allem jungen Wissenschaftler*innen, eine Plattform für Diskussionen. Hierbei waren insbesondere das Exzellenzcluster POLiS, die Universität Ulm, sowie das HIU und das ZSW beteiligt.
It is so good to be at conferences in person again, and what a fabulous and friendly crowd at #icnab for our PhD student Izzah at her first poster presentation. pic.twitter.com/hiLfVkyYff
— Energy Materials Group (Birmingham) (@EnergyMatBham) December 7, 2022
Preisverleihung der besten Poster
1. Platz (Preis von EERA JP Energy Storage: 300 EUR)
Gewinnerin: Emily Foley, UC Santa Barbara (USA)
Postertitel: „Investigating Polymorphism and Synthesis in Na2Fe2F7 and its Effect on Electrochemical Properties“
2. Platz (Preis von EERA JP Energy Storage: 200 EUR)
Gewinner: Alexander Martin Kempf, TU Darmstadt (DE)
Postertitel: „Unlocking high-rate performance in C/Sn-composites by employing an ultra-fast heating process“
3. Platz (Preis von „ChemSusChem“ book voucher at „Wiley“: 200 EUR)
Gewinner: Till Ortmann, Justus Liebig University Giessen (DE) (POLIS)
Postertitel: „Growth Behaviour of Sodium Metal at NaSICON-Type Solid Electrolyte for Reservoir-free Sodium Solid State Batteries“
4. Platz (Preis von „Batteries&Supercaps“ book voucher at „Wiley“: 100 EUR)
Gewinnerin: Silvia Porporato, Polytechnic of Turin (IT)
Postertitel: „An electrochemical investigation of electrode materials coupled with ionic liquid-based electrolytes for Na-ion batteries“
Mehr Information:
https://www.icnab22.com/
https://natron.energy/
https://www.zsw-bw.de/
7. Dezember 2022
Im Verbundprojekt CaSino arbeiten Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) mit Partnern an Batterien der nächsten Generation.
Ob Elektromobilität, tragbare Elektronik oder Netzspeicher für die Stromversorgung – ein Leben ohne Lithium-Ionen-Batterien ist heute nur schwer vorstellbar. Doch der Abbau von Lithium und weiterer notwendiger Rohstoffe wie Nickel und Kobalt verursacht hohe ökologische Kosten und stößt bald an natürliche Grenzen. Eine Alternative sind möglicherweise Calcium-Schwefel-Batterien, deren Entwicklung in dem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) koordinierten Verbundprojekt CaSino vorangetrieben wird.
Fueled by our electrolyte. And our anode which makes >5000 cycles.
Again, the challenge is the polysulfides. https://t.co/23EZQ78FDA— Maximilian Fichtner (@MaxFichtner) December 14, 2022
Erste Prototypen entstanden am HIU
„Calcium besitzt wie Lithium eine hohe Speicherkapazität und Zellspannung“, sagt Maximilian Fichtner, Direktor des vom KIT in Kooperation mit der Universität Ulm gegründeten Helmholtz-Instituts Ulm (HIU). „Es ist außerdem das fünfthäufigste Element in der Erdkruste und weltweit gleichmäßig verfügbar. Daher ist Calcium auch viel kostengünstiger als Lithium und bietet eine stabilere Materialienlieferkette.“ Mit der Entwicklung von ersten stabilen Prototypen hatte das Team am HIU bereits zuvor den Grundstein für die neue Calcium-Technologie gelegt. Durch innovative Materialentwicklung sollen in CaSino nun wesentliche Fortschritte in Bezug auf Zyklenstabilität und Energiedichte erreicht werden.
Verbesserte Elektrolyte für eine längere Lebensdauer
„Die größte Herausforderung ist nach wie vor die Reaktionsfreudigkeit des Calciums, wodurch es ungünstige Oberflächenschichten ausbildet“, erklärt Zhirong Zhao-Karger vom HIU, die das Projekt leitet. „Dank eines Elektrolyten auf Bor-Basis erzielen wir aber bereits nach dem letzten Stand der Technik die besten elektrochemischen Eigenschaften.“ Gemeinsam mit der IoLiTec GmbH, einem Spezialisten für ionische Flüssigkeiten, wird am HIU nun eine weitere Verbesserung des Elektrolyten angestrebt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert CaSino für vorerst drei Jahre.
Mehr Information:
https://www.kit.edu/kit/31698.php
12. Oktober 2022
Prof. Dr. Stefano Passerini ist mit der diesjährigen Alessandro-Volta-Medaille ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung fand bereits während des 242. Meetings der Gesellschaft für Elektrochemie (ECS) in Atlanta (USA) am 12. Oktober 2022 statt. Die Gesellschaft vergibt den Preis alle zwei Jahre für herausragende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Elektrochemie und Festkörperforschung.
Die Jury zeichnete Passerinis Forschungsaktivitäten zur Entwicklung von Materialien für Hochenergiebatterien und Superkondensatoren aus. Diese verfolgen das Ziel, nachhaltige Energiespeichersysteme aus umweltfreundlichen und verfügbaren Materialien zu schaffen.
Der italienische Chemiker, derzeit stellvertretender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm, erhielt den Preis insbesondere als Pionier auf dem Gebiet der ionischen Flüssigkeiten und der Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien. Stefano Passerini gilt seit Jahren als einer der meistzitiertesten Wissenschaftler auf diesem Fachgebiet und veröffentlichte bereits mehr als 600 Artikel in Fachzeitschriften, Büchern sowie Konferenzbeiträgen.
Natrium-Ionen-Batterien stehen in Passerinis Forschungsgruppe im Vordergrund. Diese Zellen bestehen aus Materialien, die als verfügbar, besonders preiswert, leistungsstark und gleichzeitig langlebig beschrieben werden. Deshalb gelten diese Batterien auch als nachhaltig. Schon nächstes Jahr rechnet Passerini mit dem Hochfahren der Natriumbatterie-Produktion.
Zusammen mit Passerini wurde Jerry Barker als Mitbegründer der britischen Faradion Ltd. ausgezeichnet. Das Start-up Unternehmen verkauft erste Na-Ionen-Batterien.
Die Auszeichnung besteht aus einer Silbermedaille und einem Preisgeld von 2.000 US-Dollar. Wie jeder Preisträger wurde Passerini eingeladen, einen „Volta Award-Vortrag“ zu einem Thema zu halten, das für ihn von großem Interesse ist. In diesem Vortrag („From the Oil Barrel to Reactive Metals: An Approach to the Energy Transition“) stellte Passerini verschiedene Lösungen elektrochemischer Speichermodelle vor.
Besonders reaktive, metallbasierte Speichersysteme auf Aluminium- und Natriumbasis seien laut Passerini in der Lage, alle Nachhaltigkeits- und Speicherkriterien zu erfüllen. Sowohl die Dampfverbrennung von geschmolzenem Aluminium zur Wasserstoff- und Wärmeerzeugung stellten interessante Modelle dar. Außerdem könnten flüssige Salzwasserbatterien eines Tages dabei helfen, Energie elektrochemisch in Meerwasser zu speichern.
Die Volta-Medaille wurde von der „Europa-Sektion“ der Gesellschaft für Elektrochemie im Jahre 1998 ins Leben gerufen, um herausragende Leistungen in der Elektrochemie und der wissenschaftlichen und technologischen Festkörperforschung anzuerkennen.
Alessandro Volta war ein italienischer Wissenschaftler und gilt als Erfinder der Elektrochemie. Er gilt erfand die „Volta’sche Säule“, heute bekannt als die erste elektrische Batterie. Die SI-Einheit des elektrischen Potentials (Spannung), besser bekannt als Volt, ist nach ihm benannt.
Mehr Information:
https://ecs.confex.com/ecs/242/meetingapp.cgi/Paper/168249
https://www.electrochem.org/volta-medal
https://www.electrochem.org/242/division-awards/
19. Oktober 2022
Das japanische Unternehmen Horiba vergibt seinen jährlichen Preis für innovative Arbeiten im Bereich der analytischen Messtechnik, die zur Dekarbonisierung beitragen. In diesem Jahr erhält Prof. Helge Stein, Forschungsgruppenleiter am HIU, den Preis für seine Forschung zur datengetriebenen Beschleunigung der Materialentdeckung und Hochskalierung durch korrelative Spektroskopie und Herstellung im Labormaßstab.
Der mit 500.000 Yen dotierte Preis wurde Prof. Stein verliehen, da die Jury zur Überzeugung gekomen war, dass die von ihm erreichte Automatisierung von Experimenten zur Entdeckung von Battriematerialien zur Dekarbonisierung in allen Energiesektoren eine neue Dimension erreichen wird.
Der Masao Horiba Award wurde 2003 ins Leben gerufen, um innovative Arbeiten in analytischen Messtechnologien hervorzuheben. Diese Informationen sind entscheidend für das Verständnis vieler Phänomene und bilden somit die Grundlage für neue wissenschaftliche Forschung. Diese Eigenschaften bilden auch die Grundlage für die Überführung von Werkstoffen in die industrielle Fertigung. Für die Produkt- und Prozessoptimierung sind diese Analyse- und Messtechniken unverzichtbar. Der Masao Horiba Award, benannt nach dem Gründer der HORIBA, Ltd., soll dazu beitragen, die Leistungen von Forschern zu beleuchten, die sich auf dem Gebiet der Analyse- und Messtechnik engagieren.
Visit a country for the first time and make it into local newspapers twice ✅ I think this should be a new benchmark for everyone! Thanks! pic.twitter.com/s7W4UE0lYq
— Helge S. Stein ??? (@helsoeste) October 19, 2022
Mehr Information:
https://www.postlithiumstorage.org/en/communication/news/details/helge-stein-receives-masao-horiba-award
Im Seminar des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) teilen herausragende internationale Batterieforscher ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und technologischen Erfindungen mit den Ulmer Wissenschaftlern und Studenten. Das Seminar findet jeden Dienstag um 14:00 Uhr während der Vorlesungszeit statt.
21.10.2022
Dr. Oleg A. Borodin
Battery Science Branch, US DEVCOM Army Research Laboratory, Adelphi, USA
02.11.2022
Prof. Dr. Elie Paillard
Politecnico di Milano, Milano, Italy
16.11.2022
Prof. Dr. Benjamin Butz
Micro- and Nanoanalytics Facility, University of Siegen, Germany
21.12.2022
Dr. Theresa Schoetz
Department of Chemical Engineering, The City College of New York, CUNY, NY 10031, USA
11.01.2023
Prof. Dr. Monika Schönhoff
Institute of Physical Chemistry, University of Muenster
01.02.2023
Dr. Martina Mernini
MG Marposs, Italy
06.02.2023
Dr. Nicolò Campagnol, Dr. Matthias Künzel & Monica Wang
Battery Insights by McKinsey & Company, Rue Brederode 2, 1000 Bruxelles, Belgien, RUEDSD, Belgium
06.03.2023
Dr. Manuel Smeu
Department of Physics & Materials Science and Engineering Program, Binghamton University
06. bis 08. September 2022
Über 100 Batterie-Expert*innen trafen sich vom 6. bis 8. September in Ulm, um die aktuellsten Entwicklungen von Batterien zu erörtern, die ohne Lithium auskommen. Das vierte international Symposium on Magnesium Batteries, kurz MagBatt, hat sich seit 2016 in Ulm etabliert und lockt Forschende aus der ganzen Welt an. Diesmal wurde das Programm neben Magnesium-Batterien um multivalente Batterien erweitert und in insgesamt 37 Vorträgen und einer Postersession diskutiert.
Multivalente Batterien basieren auf Magnesium, Calcium, Aluminium und Zink. Sie bieten eine interessante Alternative in Bezug auf die Energiemenge, die geliefert werden kann, die Sicherheit, die Herstellungs- und Entsorgungskosten und die begrenzten Umweltauswirkungen. Die Entwicklung völlig neuer Batteriechemien ist eine große Herausforderung. Insbesondere die hohe kationische Leitfähigkeit von mehrwertigen Kationen wie Mg2+ und Ca2+, Zn2+ oder Al3+ ist bei Umgebungstemperaturen in Festkörperelektrolyten nur schwer zu realisieren. Es wurden verschiedene Phänomene entdeckt, die die Leitfähigkeit verbessern können, wie z. B. nanopartikuläre Zusätze, Nanoeinschluss, Stabilisierung ungeordneter polymorpher Formen mit hoher Dynamik im festen Zustand usw. Auch die Entwicklung von Elektroden, die mit Hochleistungselektrolyten kompatibel sind, ist schwierig.
Mehr Information:
https://www.postlithiumstorage.org/de/news-events/detailseite/magbatt-iv
Im Seminar des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) teilen herausragende internationale Batterieforscher ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und technologischen Erfindungen mit den Ulmer Wissenschaftlern und Studenten. Das Seminar findet jeden Dienstag um 14:00 Uhr während der Vorlesungszeit statt.
25.04.2022
Prof. Dr. Bing Joe Hwang
National Taiwan University of Science and Technology & National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan
11.05.2022
Prof. Dr. B. Layla Mehdi
Department of Mechanical, Materials and Aerospace Engineering, University of Liverpool, L693GH, UK The Faraday Institution, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot OX110RA, UK
18.05.2022
Prof. Dr. Andrea Balducci
Friedrich-Schiller-University Jena, Institute for Technical Chemistry and Environmental Chemistry and Center for Energy and Environmental Chemistry Jena (CEEC Jena)
23.05.2022
Dr. Linas Vilčiauskas
Center for Physical Sciences and Technology (FTMC), Vilnius, Lithuania
24.05.2022
Prof. Po-Ya Abel Chuang
University of California, Merced, USA
08.06.2022
Prof. Xuehang Wang
Radiation Science and Technology, Faculty of Applied Sciences, TU Delft, The Netherlands
15.06.2022
Dr. Tobias Placke
MEET Battery Research Center, Institute of Physical Chemistry, University of Münster, Corrensstraße 46, 48149 Münster, Germany
20.07.2022
Prof. Alexandru Vlad
IMCN Institute, Universitè catholique de Louvain, Belgium
22.07.2022
Dr. Dominik Soyk
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany
14.09.2022
Prof. Dr. Prabeer Barpanda
Materials Research Centre, Indian Institute of Science, Bangalore, India
21. Februar 2022
ERC Starting Grant für Dr. Dominic Bresser – Schnelleres Laden durch innovative Materialien
Für die Entwicklung neuartiger Elektrodenmaterialen im Forschungsprojekt RACER erhält Nachwuchsforscher Dr. Dominic Bresser einen Starting Grant des ERC.
Langlebige Batterien, die sich schnell laden lassen, sind der Schlüssel für einen Durchbruch der klimafreundlichen Elektromobilität. Wieviel Energie eine Batterie aufnehmen kann und wie lange das Laden dauert, wird dabei unter anderem von der atomaren Struktur und den Elementen im Elektrodenmaterial physikalisch begrenzt. Im Forschungsprojekt RACER („Highly Redox-active Atomic Centers in Electrode Materials for Rechargeable Batteries“) sollen die bisherigen Grenzen nun mithilfe innovativer Materialkonzepte erweitert werden.
Great News from #Ulm! ??For the #development of #innovative #anode #materials in the RACER #research project, Dominic Bresser was ? awarded with a #Starting #Grant by the @ERC_Research. ⚡️?https://t.co/xDWJS3wIfi @KITKarlsruhe @uni_ulm @DLR_de #batteries
— Helmholtz Institute Ulm ?? (@HelmholtzUlm) February 21, 2022
„Wir nutzen dafür einen gänzlich neuen Speichermechanismus für die Ladungsträger“, sagt Dr. Dominic Bresser, der das Projekt am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) leitet. „Neben der typischen reversiblen Einspeicherung von Ionen als Ladungsträger in das Kristallgitter des Elektrodenmaterials kommen bei uns nun zusätzlich kontrollierte Redoxreaktionen auf atomarer Ebene zum Einsatz.“ Dadurch lasse sich die Energiedichte bei einer gleichzeitig hohen Schnellladefähigkeit signifikant erhöhen.
Die Forschungsgruppe von Dominic Bresser, Elektrochemische Energiespeichermaterialien, veröffentlichte kürzlich einen „Proof of Concept“ zu dem Vorhaben: „Wir wollen nun den zugrundeliegenden Mechanismus zunächst genauer verstehen. Der zweite Schritt ist das Experimentieren mit unserem Proof-of-Concept-Material Eisen und Ceroxid. In diesem Fall ist Eisen das hochgradig redox-aktive Zentrum“, sagt Bresser und fügt hinzu: „Wir wollen sehen, ob wir Eisen durch andere Elemente ersetzen können und welche Auswirkungen diese Substitution hat. Tatsächlich haben wir ein paar vorläufige Daten, die zeigen, dass wir den gleichen Mechanismus auch ohne Eisen erreichen können.“
Im Moment bietet Ceroxid die Wirtsstruktur. Cer gilt als Seltenes-Erden-Metall, obwohl Cer eigentlich so häufig vorkommt wie etwa Kupfer. „Der zweite Schritt wird sein, das Ceroxid durch viel häufiger vorkommende Elemente, wie idealerweise Titan oder Mangan, zu ersetzen. Schließlich wollen wir den Mechanismus für die Ceroxid-Wirtsstrukturen auf andere Metalloxid-Wirtsstrukturen übertragen, die idealerweise auf sehr häufig vorkommenden Metallen basieren – also umweltfreundlich, ungiftig, kostengünstig – sind. Das ist das Hauptziel dieses Projekts“, so Dr. Bresser.
Drei ERC Starting Grants für das KIT
Für seine Forschung erhält Dr. Dominic Bresser vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council – ERC) einen Starting Grant. Mit der Auszeichnung für den Nachwuchsforscher hat der ERC in der Förderrunde 2021 nun bereits drei Starting Grants an das KIT vergeben. Die ausgewählten Projekte werden für fünf Jahre mit jeweils bis zu 1,5 Millionen Euro unterstützt.
11. Februar 2022
Batterieforschung: Start für das erste vollautomatische Labor Eine neue High-Tech-Forschungsanlage beim Exzellenzcluster POLiS beschleunigt die Batterieentwicklung – Besuch der Wissenschaftsministerin zum Start
Rund um die Uhr Batterien bauen, tausende Grenzflächen analysieren, die Ergebnisse mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) autonom auswerten und dann gleich das nächste Experiment planen: Eine neue Anlage beim Exzellenzcluster POLiS erledigt die Materialentwicklung vollautomatisch und digital. Das autonome Forschungslabor entstand in einer Kooperation des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der Universität Ulm sowie des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) und ist nun in Betrieb gegangen. Beim Start mit dabei war die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
#Battery #Research ??♀️??? goes #Artificial #Intelligence in #Ulm: Some words by @TheresiaBauer, Minister for #Science of #Baden–#Württemberg, @MaxFichtner & @helsoeste @BIGMAP_EU @CELEST_18 @ClusterPolis @KITKarlsruhe @DLR_de @uni_ulm @ZSW_BW @ClusterPolis #THELAEND #AI pic.twitter.com/GL03vGvL3D
— Helmholtz Institute Ulm ?? (@HelmholtzUlm) February 10, 2022
Für die Verkehrs- und Energiewende werden neuartige leistungsfähige und nachhaltige Batterien benötigt. Dies stellt eine große Herausforderung dar, denn von der Idee bis zum fertigen Produkt dauert es mit gegenwärtigen Methoden Jahrzehnte. Mit einer nun fertiggestellten High-Tech-Anlage bei POLiS soll es zukünftig sehr viel schneller gehen. Entwickelt wurde das Leuchtturmprojekt im Exzellenzcluster POLiS, in dem das KIT gemeinsam mit der Universität Ulm an den Batterien der Zukunft arbeitet. „Mit der Förderung dieser neuen Materialentwicklungsplattform ist eine weltweit einmalige Forschungsinfrastruktur entstanden. Wir erhoffen uns einen deutlichen Schub für die Forschung an Energiespeichern, die bei der Umstellung unseres Energiesystems und unserer Mobilität unerlässlich sind. Zugleich konnten wir mit der Förderung Professor Helge Stein als einen kreativen und umtriebigen Kopf für unser Team in Ulm gewinnen“, sagt Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg, die POLiS und das HIU anlässlich des Starts besuchte.
#Batterieforschung: Start für das erste vollautomatische Labor. Eine neue High-Tech-Forschungsanlage beim Exzellenzcluster POLiS beschleunigt die Batterieentwicklung – Besuch der Wissenschaftsministerin zum Start. https://t.co/GzCdv8zrtV pic.twitter.com/k80nVj5t1y
— KIT Karlsruhe (@KITKarlsruhe) February 10, 2022
Weltweit erste vollintegrierte Plattform zur beschleunigten Forschung zur elektrochemischen Energiespeicherung
Helge Stein, Tenure-Track-Professor am KIT und POLiS-Forschungsbereichssprecher erklärt die Vorzüge der Anlage: „Wir sind nun in der Lage, Batterien und deren Einzelkomponenten automatisiert zu synthetisieren und zusammenzubauen, eine Messung anzustoßen und diese vollautomatisiert auszuwerten. Basierend auf der Datenlage kann die KI-gestützte Anlage sogar entscheiden, welches Experiment als nächstes durchgeführt werden soll.“ Mit seiner Forschungsgruppe hat Stein die zugrundeliegende kombinatorische Materialsynthese, die Hochdurchsatz-Charakterisierung sowie die Data-Mining-Techniken unter Zuhilfenahme von Methoden der KI in der Versuchsauswertung und -planung entwickelt. Die Anlage mit dem Namen PLACES/R (Platform for Accelerated Electrochemical Energy Storage Research) stellt die weltweit erste vollintegrierte Plattform zur beschleunigten Forschung zur elektrochemischen Energiespeicherung dar.
Neues Paradigma für die Batteriematerial-Entwicklung
Batterieforschung ist geprägt von der Suche nach der idealen Kombination aus Materialien, deren Zusammensetzung und Verfahrenstechniken. Alle möglichen Variationen mit allen Materialien zu testen, würde mit klassischen Methoden allerdings Jahrtausende in Anspruch nehmen. „Unsere Anlage kann mehrere hundert solcher Variationen am Tag testen. Dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen Lebenswerk eines Forschenden“, so Stein. Neben der Beschleunigung durch Automatisierung kann durch die Algorithmen und KI eine zusätzliche, um den Faktor zehn schnellere Optimierung erreicht werden und vielversprechende Batteriekonzepte damit noch schneller und kostengünstiger zur Marktreife gebracht werden.
Eingebettet ist die neue Forschungsanlage in einen europäischen Rahmen: Die erfassten Daten aus allen Bereichen des Batterieentwicklungszyklus werden mit 34 Institutionen aus 15 Ländern im Projekt BIG-MAP der europäischen Forschungsinitiative BATTERY2030+ geteilt. „Das vollautomatisierte Labor wird uns und unsere europäischen Partner nicht nur in die Lage versetzen, Komponenten für neue Batterien viel schneller entwickeln zu können. Es wird auch sicherstellen, dass Batterien zu so niedrigen Kosten hergestellt werden können, dass es in Zukunft noch attraktiver sein wird, Strom zum Beispiel aus Sonne und Wind in Batterien zu speichern“, sagt Professor Maximilian Fichtner, geschäftsführender Direktor des HIU sowie Sprecher von POLiS.
After checking out @helsoeste's new labs at @ClusterPolis, Minister Theresia Bauer followed a couple of scientific presentations at HIU. Core message: Ulm's #battery ? research is based on cooperation: @ZSW_BW @uni_ulm @KITKarlsruhe @CELEST_18 #THELAEND https://t.co/tX19W1lt4T pic.twitter.com/iSvCc0mLxm
— Helmholtz Institute Ulm ?? (@HelmholtzUlm) February 10, 2022
Weitere Informationen:
https://www.kit.edu/kit/pi_2022_011_batterieforschung-start-fur-das-erste-vollautomatische-labor.php
10. Dezember 2021
Intl. Symposium über Modellierung von Brennstoffzellen und Batterien
In diesen Tagen bereitet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die 18. Neuauflage des Symposiums „Modval“ vor. Die Konferenz findet vom 14.-16. März 2022 statt und wird vom Helmholtz-Institut Ulm und dem Exzellenzcluster POLiS koorganisiert. Mehr als 100 Teilnehmer werden zum Forschungsaustausch erwartet.
Veranstaltung: Modval18 wird in Anwesenheit abgehalten
COVID-19 Einschränkungen: Es gilt die „2G“-Regel. Wir sorgen für größtmögliche Sicherheit.
Registrierungslink: Registrierung zur Veranstaltung
Datum: 14.-16.03.2022

Modval18
Modval18 ist die 18. Veranstaltung eines internationalen Symposiums zur Modellierung und experimentellen Validierung von Brennstoffzellen und Batterien. Das 2004 ins Leben gerufene Symposium zielt darauf ab, Forscher*innen aus Wissenschaft und Industrie sowie Theoretiker*innen und Experimentator*innen zusammenzubringen. Der jährlich im März stattfindende Veranstaltungsort wechselt zwischen Deutschland und der Schweiz und wird immer von einer wissenschaftlichen Einrichtung ausgerichtet. Dieses Mal wird es vom DLR-Institut für Technische Thermodynamik mit Sitz in Stuttgart organisiert. Das DLR modelliert Batterien als Partner des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU).
Schwerpunkt des Symposiums ist die Präsentation und Diskussion der neuesten Forschungsergebnisse, der Fortschritte in der Modellierung sowie experimenteller Arbeiten zur Modellvalidierung für Brennstoffzellen, Batterien und Elektrolyse. Die Konferenz konzentriert sich auf die Modellierung und Validierung von elektrochemischen Energiegeräten. Beitragende Autoren werden ermutigt, der Validierung ihrer Modellierungsansätze besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Innovative Batterie- und Brennstoffzellenmodelle sind sehr willkommen.
Das Symposium wird mindestens folgende Themen behandeln:
„Modeling and Simulation“
„Validation“
„Call for Abstracts“ (bis 31. Dezember, 2021)
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an einer Präsentation / Posterpräsentation auf der Modval18. Wir freuen uns, Ihr Abstract zu lesen und freuen uns, dass Sie sich für eine aktive Teilnahme an dieser Konferenz entschieden haben. Wie in den Vorjahren wird das Modval18 eingeladene Vorträge, Beiträge mit Beiträgen und Posterpräsentationen bieten.
Weitere Informationen: