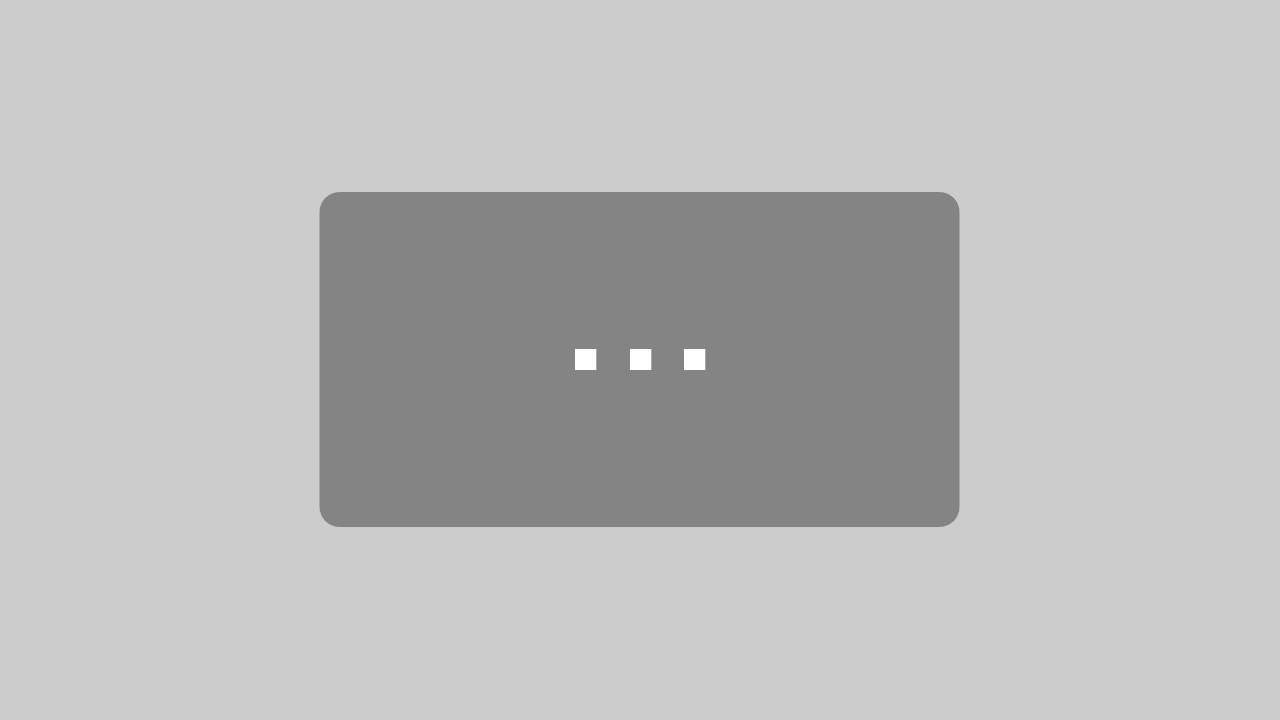
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
23.12.2020
Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens, Leiterin der Batterieforschung am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und Forschungsbereichsleiterin bei POLiS, ist mit einem der bedeutendsten internationalen Batteriepreise ausgezeichnet worden. Die International Battery Materials Association (IBA) verlieh ihr den Technology-Award 2020. Sie habe mit ihrer Arbeit maßgeblich zur Weiterentwicklung der Batterietechnologie in den vergangenen Jahrzehnten beigetragen.
ZSW-Forscherin erhält IBA Technology Award: Foto: ZSW/ SWU, Rampant-pictures.deDer IBA-Technology-Award geht an Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Ulm. https://t.co/CCL9EYpKe6 pic.twitter.com/ax2ffF9dYG
— Solarserver (@Solarserver) December 22, 2020
Die IBA ist die bedeutendste Vereinigung der Batterieforscher weltweit. Mit den jährlich verliehenen IBA-Awards zeichnet die Vereinigung bedeutende Beiträge zur Batterieforschung und Technologieentwicklung aus, die sich auf die Weiterentwicklung von Energiespeichersystemen ausgewirkt haben. So erhielten 2020 unter anderem die letztjährigen Chemienobelpreisträger Stanley Whittingham, John B. Goodenough und Akira Yoshino die „IBA Medal of Excellenz“ für ihre außergewöhnlichen und lebenslangen Beiträge zur Entwicklung der Lithium-Ionen-Technologie.
Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens forscht seit 1990 am ZSW-Standort Ulm und leitet beim Helmholtz-Institut Ulm die Forschungsgruppe „Composites & Hybrid Materials„. Die Ulmer Wissenschaftlerin erhielt den „IBA-Technology-Award“ für herausragende Beiträge in der angewandten, industrienahen Forschung und Entwicklung von Batterien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Material- und Prozessentwicklung für Lithium-Ionen-Batterien und Post-Lithium-Speichersysteme sowie auf der Produktionsforschung und auf die Untersuchung von Alterungsmechanismen von Lithium-Ionen-Batterien.
09.12.2020
Passgenaue Materialien könnten die Entwicklung leistungsfähiger Batterien, hochgenauer Sensoren oder innovativer Informationstechnologien erheblich beschleunigen. Bisher galt ein solches Materialdesign nach Maß von der atomaren Ebene aufwärts jedoch als Zukunftsmusik. Dies will Professor Carsten Streb mit seinem neuen Projekt „SupraVox“ ändern: Der Chemiker plant, den Polymerisationsprozess von Metalloxiden zu ergründen und letztlich die Kontrolle über Struktur und Reaktivität solcher Materialien zu erlangen. Dafür hat der Wissenschaftler, der am Uni-Institut für Anorganische Chemie I und als Principal Investigator am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) forscht, einen ERC Consolidator Grant über rund 2 Millionen Euro eingeworben. Mit diesem Förderinstrument ermöglicht der Europäische Forschungsrat (ERC) herausragenden Wissenschaftlern über fünf Jahre die Umsetzung wegweisender Konzepte und stärkt so die europäische Forschungslandschaft.
Das Projekt SupraVox nimmt eine der großen Herausforderungen der Materialchemie an: Die Forschenden um Professor Carsten Streb wollen die kontrollierte Synthese von Metalloxiden und somit ein gezieltes Materialdesign ermöglichen – von der atomaren Ebene bis hin zu Nano- und Mikrostrukturen. Solche planvoll hergestellten Materialien wären ein Meilenstein auf dem Weg zu effizienten Energietechnologien, zur klimafreundlichen Mobilität und zur industriellen Katalyse. „In der Materialwissenschaft haben Computersimulationen große Fortschritte gemacht: Sie erhöhen das Verständnis für chemische Prozesse und ersetzen viele Laborexperimente. Die Metalloxid-Synthese wird allerdings noch immer nach dem Trial-and-error-Prinzip durchgeführt. Mit dem Projekt SupraVox wollen wir das fundamental ändern und eine kontrollierbare Metalloxid-Polymerisation etablieren“, erklärt Streb. Dafür fehlten den Forschenden bisher ein detailliertes Verständnis der Polymerisationsprozesse sowie die Kontrolle über die gezielte Verknüpfung von einzelnen Bausteinen zu langen Molekülketten.
We are very proud to announce that HIU Professor @carsten_streb has acquired an ERC Consolidator Grant. ??? His aim is to revolutionize #material design for #future technologies. @ClusterPolis @CELEST_18 https://t.co/ZBRI9bGSUb
— Helmholtz Institute Ulm (@HelmholtzUlm) December 9, 2020
Die idealen Bausteine für eine solche einstellbare Materialklasse sind molekulare Metalloxide, so genannte Polyoxometallate (POMs). Bei diesen Monomeren können Struktur und Reaktivität auf molekularer Ebene verändert werden. Über viele Jahre hat die Gruppe von Carsten Streb Pionierarbeit zu Polyoxometallaten geleistet. Sie entwickelten neuartige, selbstheilende Antikorrosions-Beschichtungen (POM-IL), multifunktionelle Komposite zur Wasseraufbereitung oder hochaktive Katalysatoren zur Sonnenlicht-getriebenen Erzeugung von Wasserstoff.
Dennoch verhindern Wissenslücken, etwa hinsichtlich des Übergangs von einzelnen POM-Molekülen zu polymeren Metalloxiden, ein wirklich kontrolliertes Materialdesign.
Im Forschungsvorhaben SupraVox setzen Streb und seine Arbeitsgruppe auf Vanadium-basierte POMs (V-POMs): Anhand dieser Modell-Monomere wollen sie die Polymerisationschemie im Detail verstehen, beeinflussen und zielgenau das Wachstum von V-POM-Ketten ermöglichen. Dadurch werden neue chemische und elektronische Eigenschaften zugänglich, die verschiedensten Hochtechnologien zugutekommen. Bis dahin gilt es, zahlreiche Fragen zwischen molekularer- und Festkörperchemie zu beantworten: Welche supramolekularen Mechanismen steuern die Polymerisation? Wie interagieren die Polymerketten mit ihrer Umgebung? Und wie hängen Struktur, elektronische Eigenschaften und Reaktivität der V-POM-Polymere zusammen? Den Bogen in die Anwendung schlagen hingegen Untersuchungen an den Grenzflächen von Vanadiumoxid-Polymeren, die auf Elektrodenoberflächen platziert werden. Unter anderem mithilfe von hochauflösender Elektronenmikroskopie sollen so Erkenntnisse für Batterie- und Katalysatordesign gewonnen werden. Insgesamt wird SupraVox anhand von V-POMs Polymerisationskonzepte aufzeigen, die auf andere Metalloxide übertragen werden können. Letztlich sollen Trial-and-error-Synthesen durch vorhersehbares Materialdesign ersetzt werden.
Die Forschungsumgebung an der Universität Ulm und am benachbarten, auf die Batterieforschung spezialisierten Helmholtz-Institut Ulm sind ideal. Beide Einrichtungen sind weltweit führend in der Charakterisierung funktionaler Nanomaterialien und verfügen über die höchst entwickelten Analysesysteme – vom Supermikroskop SALVE über Elektrochemie-Labore bis hin zu Simulationen, womöglich mithilfe des Supercomputers JUSTUS 2.
„SupraVox wird Zugang zu einer bisher unbekannten Materialklasse mit vielfältigen Anwendungsgebieten eröffnen. Ich bin überzeugt, dass wir wichtige Entwicklungen für Zukunftstechnologien wie nachhaltige Energiespeicherung und Quantenelektronik ermöglichen werden“, resümiert Professor Carsten Streb.
Zum ERC Consolidator Grant ERC
Consolidator Grants richten sich an exzellente Forschende in der Konsolidierungsphase. Mit den Fördermitteln sollen sie vor allem beim Ausbau ihrer unabhängigen Arbeitsgruppe und bei der Steigerung ihrer internationalen Sichtbarkeit unterstützt werden. Typischerweise bewerben sich vielversprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen sieben bis zwölf Jahre nach ihrer Promotion. Über die Qualität der eingereichten Anträge entscheidet eine internationale Jury, beraten durch externe Experten. Für ihre Projekte erhalten die ausgewählten Forschenden bis zu 2 Millionen Euro für fünf Jahre (dazu kommt in einigen Fällen ein Startbudget). 2020 sind 2506 Anträge eingereicht worden. Davon wurden 327 Forschende aus 23 europäischen Ländern für einen ERC Consolidator Grant ausgewählt. Einziges Kriterium ist die wissenschaftliche Exzellenz der Forschenden und des vorgeschlagenen Projektes. Das Fördervolumen beträgt insgesamt 655 Millionen Euro. https://erc.europa.eu/
18.11.2020
Acht Forschende des KIT sind dieses Jahr unter den meistzitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit. Ebenfalls dabei: zwei Batterieforscher. Neben Professor Jürgen Janek wird HIU-Direktor Prof. Stefano Passerini zu den einflussreichsten Forscherinnen und Forschern gezählt. Passerini gilt schon seit 2015 zu den bedeutendsten Wissenschaftlern weltweit.
Our Director at HIU, Prof. Stefano Passerini is again among the #HighlyCitedResearchers 2020. His team and the entire institute are very proud. His statement ?⚡️? pic.twitter.com/mGd12i68Qk
— Helmholtz Institute Ulm (@HelmholtzUlm) November 19, 2020
Die Nennung des eigenen Werkes in anderen Publikationen ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen immens wichtig. Die Zitierhäufigkeit ist ein wesentliches Indiz für den Einfluss und das Ansehen innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dieses Jahr sind – neben Passerini – sieben weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT unter den „Highly Cited Researchers“, einer von der „Web of Science Group“ geführten Rangliste. Sie nennt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Publikationen am häufigsten zitiert wurden. Für die aktuelle Liste werteten die Autoren Veröffentlichungen der Jahre 2009 bis 2019 aus. Eine Publikation gilt erst dann als „Highly Cited“, wenn sie in ihrem Fachgebiet und ihrem Erscheinungsjahr zu den Top 1 % der Gesamtzitationen zählt.
Zu den „Highly Cited Researchers“ des KIT in diesem Jahr gehören:
– Professorin Almut Arneth, Leiterin der Abteilung „Ökosystem-Atmosphäre Interaktionen“ am Institut für Meteorologie und Klimaforschung – Atmosphärische Umweltforschung
– Professor Klaus Butterbach-Bahl, Leiter der Abteilung „Bio-Geo-Chemische Prozesse“ am Institut für Meteorologie und Klimaforschung – Atmosphärische Umweltforschung
– Dr. Amir-Abbas Haghighirad, Institut für Quanten-Materialien und Technologien
– Professor Jürgen Janek, Institut für Nanotechnologie, Wissenschaftlicher Leiter des Gemeinschaftslabors BELLA von KIT und BASF SE sowie Forschungsgruppenleiter an der Justus-Liebig-Universität Gießen
– Professor Stefano Passerini, Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm und Leiter der Forschungsgruppe „Elektrochemie der Batterien“
– Professor Holger Puchta, Leiter des Botanischen Instituts und Leiter der Arbeitsgruppe „Molekularbiologie und Biochemie“
– Professor Alexandros Stamatakis, Institut für Theoretische Informatik und Forschungsgruppenleiter am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS)
– Professor Martin Wegener, Institut für Angewandte Physik, Wissenschaftlicher Direktor am Institut für Nanotechnologie und Sprecher des Exzellenzclusters „3D Matter Made to Order“
Seit Januar 2014 ist Passerini als Professor am Helmholtz-Institut Ulm tätig. Von 2015 bis 2018 war er stellvertretender Direktor des Instituts. Seit dem 10.10.2018 leitet er das HIU als Direktor. Er arbeitet seit 30 Jahren an der Entwicklung von Materialien und Systemen für elektrochemische Energiespeicherung. Mit seiner Forschung konzentriert er sich auf das grundlegende Verständnis und die Entwicklung von Materialien für Lithium-Batterien, wie ionische Flüssigkeiten, Polymer-Elektrolyte und Elektrodenmaterialien.
04.11.2020
Besondere Ehrung für die Jung-Wissenschaftlerin Dr. Montaha Anjass. Die 32-jährige ist eine von acht Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus Baden-Württemberg, denen am Mittwoch der mit 5.000 Euro dotierte Förderpreis des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall verliehen wurde. Anjass erhielt die Auszeichnung für ihre Dissertation an der Universität Ulm zum Thema „Experimental and theoretical reactivity studies of molecular metal oxides for energy conversion and storage”.
Die Doktorarbeit befasst sich mit der Herstellung verschiedener molekularer Metalloxide und der Untersuchung auf ihre Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf ihre Eignung als Aktivmaterial in elektrochemischen Speichern. Die Dissertation basiert auf einer bemerkenswerten Anzahl von sechs begutachteten Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften, die einen weiten Forschungsbereich abdecken von grundlegenden elektrochemischen Untersuchungen über Stabilitätsanalysen bis hin zum Alterungsverhalten in elektrochemischen Laborzellen bzw. Batteriezellen.
Mit dem Förderpreis würdigt Südwestmetall seit über 30 Jahren herausragende Dissertationen des wissenschaftlichen Nachwuchses mit besonderer Bedeutung für die industrielle Arbeitswelt und deren sozialpolitischen Rahmenbedingungen. Der Südwestmetall-Vorsitzende Dr. Stefan Wolf lobte die große thematische Bandbreite der diesjährigen prämierten Dissertationen. In Richtung Landesregierung forderte er eine stärkere Unterstützung der Hochschulen bei der Digitalisierung ein: „Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Sommersemester als digitales Semester angeboten worden. Auch das laufende Semester wird voraussichtlich überwiegend digital stattfinden. Die Erfahrungen daraus müssen nun genutzt werden, um auf dem Weg zu einem ‚Campus 4.0‘ ein großes Stück voranzukommen.“
I’m incredibly honored to be awarded the Südwestmetall Förderprise 2020! Many thanks to everyone who helped me along the way!
Thanks a lot! @Suedwestmetall@uni_ulm, @HelmholtzUlm https://t.co/NhmtcqliND— Montaha Anjass (@AnjassMontaha) November 4, 2020
Die Digitalisierung von Hochschullehrangeboten und der Studierendenservices sei allerdings sehr ressourcenintensiv, bemerkte der Arbeitgebervertreter. Die Landesregierung müsse die Hochschulen deshalb dabei finanziell noch stärker unterstützen, forderte Wolf: „Das Land hat dafür zwar bereits 40 Millionen Euro bereitgestellt. Dies gleicht aber lediglich den Mehrbedarf der Hochschulen für den Online-Studienbetrieb im Sommersemester aus. Für eine nachhaltige Digitalisierung der Hochschulen müssen die finanziellen Mittel verstetigt werden. Deshalb ist hier ein Digitalpakt mit längerer Laufzeit notwendig.“
Text: Thomas Widder (Südwestmetall)
29.10.2020
Wissensbausteine für Batteriezellen „Made in Germany“
Die Herstellung von Batteriezellen erfolgt in vielen Prozessschritten. Es wird gemischt, gerührt, beschichtet, gewalzt, geschnitten, gestapelt. Wie die Qualität des finalen Produkts verbessert werden und die Produktion kostengünstiger und umweltschonender ablaufen kann, daran arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ProZell. Das Kompetenzcluster zur Batteriezellproduktion, an dem auch Ulmer Forschende beteiligt sind, wird seit 2016 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Damit die Forschungsergebnisse schnell in die industrielle Anwendung überführt werden, setzt ProZell verstärkt auf Wissenstransfer in die Industrie. In diesem Jahr fand die dritte Auflage des ProZell-Industrietags am 27. Oktober 2020 in einem digitalen Konferenzformat statt.
„Wir wollen mit der Forschung in ProZell intensiv zum BMBF-Dachkonzept ‚Forschungsfabrik Batterie‘ beitragen und eine international wettbewerbsfähige industrielle Produktion von Batteriezellen in Deutschland und Europa etablieren“, sagt Professor Arno Kwade, Sprecher des Kompetenzclusters ProZell und Leiter des Instituts für Partikeltechnik der Technischen Universität Braunschweig. „Wir demonstrieren schon heute, was im Labor- und Pilotmaßstab alles erfolgreich möglich ist. Jetzt gilt es, das Gelernte in die industrielle Nutzung zu überführen.“
Das Cluster fördert den Dialog zwischen Forschung und Wirtschaft durch die Organisation eines Industrietags, um weitere Kooperationen zu etablieren und industrielle sowie wissenschaftliche Anforderungen auszuloten. Am 27. Oktober 2020 stellten die Cluster-Mitglieder ihre Forschungsergebnisse vor. Es konnte beispielsweise gezeigt werden, dass durch dickere Elektroden in Batteriezellen eine Erhöhung der Energiedichte erreicht werden kann. Einzelne Herstellungsprozesse konnten beschleunigt werden und führen damit zu einer Senkung der Produktionskosten. Darüber hinaus wurden neue Prozesstechnologien zur Herstellung von Batterieelektroden präsentiert, die mit geringeren Mengen oder ganz ohne Lösungsmittel auskommen, Materialkosten einsparen und so den ökologischen Fußabdruck verbessern.
Das Helmholtz-Institut Ulm (HIU) ist als Gemeinschaftsforschungseinrichtung über das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Kompetenzcluster beteiligt.
Auch in Ulm kooperieren Forschende im Rahmen von #ProZell, um die Herstellung von Batteriematerialien zu optimieren. *red #uulm @HelmholtzUlm @DLR_de @ZSW_BW #battery https://t.co/qXM49OEAL5
— Universität Ulm (@uni_ulm) October 28, 2020
Batterieforschung per Computersimulation
Batterieforschung findet aber nicht nur im Labor, sondern auch per Computersimulation statt. In Ulm kooperiert das Institut für Stochastik der Universität mit dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Helmholtz-Institut Ulm (DLR/HIU) sowie dem Helmholtz-Zentrum Berlin und der TU Braunschweig. Mithilfe statistischer Bildanalyse und stochastischer 3D-Strukturmodellierung wird versucht, Zusammenhänge zwischen geometrischen Strukturkenngrößen auf der Mikroskala und elektrochemischen Eigenschaften der Batterieelektroden aufzuklären. Diese beeinflussen letztlich die Leistung der Zelle. Die Arbeiten basieren auf realen Elektrodenmaterialien, deren Mikrostruktur mittels hochauflösender Bildgebung zugänglich gemacht wird.
„Nach einer Aufbereitung der 3D-Bilddaten werden mit Methoden der Stochastik virtuelle Elektrodenmaterialien am Computer generiert, die den Beobachteten in statistischem Sinne ähnlich sind“, so Dr. Matthias Neumann vom Institut für Stochastik der Uni Ulm. Zusätzlich können dann auch virtuelle, aber dennoch realistische Bilddaten von Elektrodenmaterialien am Computer erzeugt werden, die sich von den bereits hergestellten Materialien zum Beispiel hinsichtlich ihrer Dicke oder Porosität unterscheiden. Diese Bilddaten werden anschließend für die simulationsbasierte Bestimmung der zugehörigen elektrochemischen Eigenschaften bereitgestellt. Die Ergebnisse der virtuellen Materialoptimierung sollen als Empfehlungen zu einer optimierten Herstellung der Batteriematerialien beitragen. Am diesjährigen Industrietag wurden insbesondere neue Ergebnisse zur Aufbereitung der Bilddaten unter Verwendung statistischer Lernverfahren wie zum Beispiel künstlicher neuronaler Netze vorgestellt.
Das Kompetenzcluster ProZell
Das lebendige ProZell-Netzwerk schafft in Zusammenarbeit mit dem BMBF, dem Kompetenznetzwerk für Lithium-Ionenbatterien (KLiB) und dem Managementkreis von ProZell erfolgreich Synergien zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ziel ist es, die Grundlagen für eine leistungsstarke und kostengünstige Batteriezell-Produktion „Made in Germany“ zu schaffen. Netzwerk-Partner sind die TU Braunschweig, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Hochschule Landshut, die TU Berlin, die TU Clausthal, die TU Bergakademie Freiberg, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt via des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU), die Universität Ulm, die RWTH Aachen, die TU Dresden, die TU München, die WWU Münster via des MEET Batterieforschungszentrum Münster, die Fraunhofer-Gesellschaft und das Forschungszentrum Jülich via des Helmholtz-Instituts Münster.
Im Seminar des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) teilen herausragende internationale Batterieforscher ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und technologischen Erfindungen mit den Ulmer Wissenschaftlern und Studenten. Das Seminar findet jeden Dienstag um 14:00 Uhr während der Vorlesungszeit statt.
20.10.2020
Dr. Martin Finsterbuch
Forschungszentrum Jülich, Jülich (online)
27.10.2020
Dr. Yvonne Grunder
University of Liverpool, Liverpool (online)
03.11.2020
Prof. Enrico Bodo
University of Rome, Rome (present at HIU)
10.11.2020
Dr. Holger Althues
Abteilung Chemische Oberflächen- und Batterietechnik, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, Dresden (online)
26.11.2020
Dr. Marion Chandesris
CEA Liten, Grenoble (online)
2021
09.02.2021
Martin Bazant
MIT
11.02.2021
Dr. Christina Iojoiu
LEPMI, Grenoble
16.02.2021
Kinberly See
Caltech
15.10.2020
Ausstellungsort: Münsterplatz 25, 89073 Ulm
Datum: 15. April 2021 bis 15.07.2021 (Verlängerung evtl. möglich)
Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr, Veranstaltungen: jeden Donnerstagabend
Die Stadt Ulm feiert den Geburtstag von Albrecht Ludwig Berblinger. Am 24. Juni 2020 wäre er 250 Jahre alt geworden: ein ebenso genialer wie risikofreudiger Erfinder aus Ulm. Besser bekannt als „Schneider von Ulm“ ging er mit seinem gescheiterten Flugversuch im Jahr 1811 in die Geschichte ein. Die Jubiläumsfeierlichkeiten unter dem Titel „Berblinger 2020“ sollen nicht nur sein Wirken würdigen, sondern vor allem die Themen Innovation, Erfindergeist, Mut sowie eine für Veränderung offene Stadtgesellschaft in den Fokus rücken.
Zwischen dem Juni 2020 und Mai 2021 lädt die Stadt Ulm zu zahlreichen Veranstaltungen und Kulturangeboten zum Mitfeiern ein. Das Helmholtz-Institut Ulm (HIU) beteiligt sich an den Feierlichkeiten mit einer eigenen Ausstellung in den Räumen des „Münsterplatzes 25“, einem Museumstrakt neben dem Ulmer Münster.
Batterie-Ausstellung
Die Ausstellung trägt den Titel „Akku Alle – Elektromobilität und Energiespeicher“ und spiegelt die komplette Bandbreite der Ulmer Batterieforschung wider. Erstmals richten damit alle an der Ulmer Batterieforschung beteiligten Wissenschaftsinstitutionen (Helmholtz-Institut Ulm, Exzellenzcluster POLiS, Forschungsplattform CELEST, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Universität Ulm, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und Karlsruher Institut für Technologie) gemeinsam eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit aus.
Ausstellung Akku Alle – Elektromobilität und Energiespeicher
Neben einer „Blackout“-Simulation für Ulm im Jahre 2029, bei der ein sechstätiger Stromausfall in der Region Donau-Iller simuliert wird, werden hochkarätige Exponate aller beteiligter Wissenschaftsinstitute ausgestellt. So auch das Wasserstoffflugzeug Hy4 des DLR.
Das Besondere an dem Flugzeugmodell: Die echte, mit einer Brennstoffzelle betriebene viersitzige Passagiermaschine Hy4 fliegt während der Ausstellung tatsächlich über den Dächern Ulms die Donau entlang. Der Flug der Hy4-Maschine realisiert also genau den Traum, bei dem der „Schneider von Ulm“ Albrecht Ludwig Berblinger im Jahr 1811 gescheitert war.
Ausstellungslink: www.akku-alle.de
04.09.2020
Die Projekte der europäischen Forschungsinitiative BATTERY 2030+ haben alle Ihre Forschung aufgenommen. Ziel ist es, Europa bei der Entwicklung und Produktion der Batterien der Zukunft an die Weltspitze zu bringen. Diese Batterien müssen mehr Energie speichern, eine längere Lebensdauer haben und sicherer und umweltfreundlicher als die heutigen Batterien sein, um den Übergang zu einer klimaneutraleren Gesellschaft zu erleichtern. Das Projekt wird von der Universität Uppsala geleitet. Über die Forschungsplattform CELEST sind das KIT und die Universität Ulm mit ihrem gemeinsamen Helmholtz-Institut Ulm (HIU) beteiligt. Gleichzeitig verstärkt das Projekt die Forschungsaktivitäten vom Exzellenzcluster POLiS.
„Wir sind endlich einsatzbereit! Dies ist eine wichtige langfristige Forschungsinvestition auf dem Gebiet der Batterien, die Europas Forschungsposition stärken und dazu beitragen wird, eine Industrie zu haben, die die Batterien der Zukunft herstellen kann“, sagt Professor Kristina Edström von der Universität Uppsala, die Koordinatorin von BATTERY 2030+ ist. „Wir arbeiten seit mehreren Jahren an der Roadmap, auf die wir unsere Forschungsanstrengungen stützen und die wir im März dieses Jahres vorgestellt haben. Jetzt beginnen die verschiedenen Forschungsprojekte, und wir sorgen dafür, dass unsere Ideen zu neuem Wissen und neuen Produkten führen – und natürlich zu besseren Batterien.
Ab dem 1. September besteht diese große Initiative aus sieben Projekten mit einem Gesamtbudget von 40,5 Millionen Euro aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der EU.
BATTERY 2030+ ist ein großes Forschungsumfeld, wobei Schweden und die Universität Uppsala die Gesamtaktivitäten koordinieren. Ziel ist es, umweltfreundlichere und sicherere Batterien mit besserer Leistung, größeren Lagermöglichkeiten und längerer Lebensdauer zu schaffen. Die aktuellen Forschungsprojekte sind in drei verschiedenen Bereichen angesiedelt:
I. Entwicklung einer europäischen Infrastrukturplattform zur Kombination von groß angelegten Berechnungen und experimentellen Studien, um die komplexen Reaktionen, die in einer Batterie ablaufen, abzubilden.
II. Entwicklung und Integration von Sensoren, die den Zustand der Batterie in Echtzeit untersuchen und darüber berichten.
III. Entwicklung von selbstheilenden Komponenten, die die Lebensdauer der Batterie verlängern und die Sicherheit verbessern.
Read our press release: https://t.co/YRHmg9WNq9.@BIGMAP_EU @FutureTechEU @EU_Commission #researcheu #batteries #innovation https://t.co/dM2gtnbuwI pic.twitter.com/6Jr6vxqLvz
— BATTERY 2030 + (@2030Battery) September 14, 2020
Fakten zu den Projekten
BIG-MAP (www.big-map.eu) unter der Leitung von Professor Tejs Vegge, Technische Universität Dänemark, ist ein Projekt, das KI-unterstützte Methoden entwickeln wird, um die Entdeckung neuer Materialien und Batteriekonzepte zu beschleunigen. Es basiert auf der Schaffung neuer Berechnungsmodelle und experimenteller Methoden, die Hand in Hand gehen können, um die komplexen Reaktionen zu verstehen, die innerhalb der Batterie ablaufen. Es versucht zu verstehen, welche Elektrodenmaterialien und Elektrolyte am besten kombiniert werden können, damit eine Batterie so viel Energie wie möglich speichern oder in verschiedenen Situationen schnell geladen werden kann. Die Liste der Partner umfasst akademische und industrielle Führungskräfte sowie große Forschungsinfrastrukturen in Europa, wie Synchrotron- und Neutronenanlagen sowie Hochleistungsrechenzentren.
INSTABAT, unter der Leitung von Dr. Maud Priour, CEA Frankreich, wo vier eingebettete physikalische Sensoren (optische Fasern mit Fiber-Bragg-Gitter und Lumineszenzsonden, Referenzelektrode und photoakustischer Gassensor) und zwei virtuelle Sensoren (basierend auf elektrochemischen und thermischen reduzierten Modellen) entwickelt werden, um eine zuverlässige operando-Überwachung der Schlüsselparameter von Batteriezellen durchzuführen.
Unter der Leitung von Jon Crego, Ikerlan in Spanien, wird SENSIBAT Sensoren entwickeln, die die interne Temperatur, den Druck, die Leitfähigkeit und die Impedanz von Batterien messen. Diese Sensoren werden in ein Batteriesystem integriert und ermöglichen die Entwicklung fortschrittlicher Batteriezustandsalgorithmen. Die Ergebnisse werden verwendet, um eine genauere Steuerung und eine höhere Leistung der Batterie während ihrer gesamten Lebensdauer zu erreichen.
SPARTACUS unter der Leitung von Gerhard Domann, Fraunhofer ISC, Deutschland, wird integrierte akusto-mechanische und thermische Sensoren entwickeln und sie mit fortschrittlicher Impedanzspektroskopie kombinieren, um Reaktionen, die zu einer Verschlechterung der Batterie führen, zu erkennen und zu verstehen. Diese umfassende Sensorlösung wird ein fortschrittliches Batteriemanagement ermöglichen, das ein schnelles Laden von Batteriemodulen ohne wesentliche negative Auswirkungen auf Lebensdauer und Sicherheit ermöglicht.
BAT4EVER unter der Leitung von Dr. Maitane Berecibar, Vrije Universiteit Brussel, zielt auf die Entwicklung und Untersuchung eines neuen Typs von Lithium-Ionen-Batterien ab, der selbstheilende Polymere in Siliziumanoden, Kathoden mit Kern-Hülle-Struktur und Elektrolyten integriert. Die selbstheilenden Batterien von BAT4EVER werden die Mikroschäden tolerieren und Elementverluste während mehrfacher Aufladezyklen ausgleichen. Sie werden sicherer und haltbarer sein und durch die Einführung ausgeklügelter Heilungsmechanismen mehr Energie speichern und behalten als heutige Batterien.
HIDDEN wird von Dr. Marja Vilkman, VTT, Finnland, geleitet. Das Projekt wird neue Arten von Elektrolyten und Separatoren mit „selbstheilenden“ Eigenschaften untersuchen. Die Herausforderung besteht darin, Festphasenbatterien mit Lithiummetall als negativer Elektrode herzustellen, um die Kapazität der Batterie zu erhöhen.
BATTERY 2030+ (https://battery2030.eu/about-us/partners/core-group/) wird von Professor Kristina Edström von der Universität Uppsala geleitet. Das Projekt ist eine Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahme, die die gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen der Initiative BATTERY 2030+ erleichtern wird, wie z.B. Verbreitung, Datenaustausch, Lehrpläne, Nutzungsstrategien und Weiterentwicklung der Roadmap. Darüber hinaus wird das Projekt starke Verbindungen zu nationalen Batterienetzwerken sicherstellen und eng mit anderen großen europäischen Batterieinitiativen wie der European Battery Alliance und Batteries Europe zusammenarbeiten.
20.08.2020
Prof. Maximilian Fichtner, Stv. Direktor am HIU, war am 20. August 2020 zu Gast in der Fernsehsendung „Scobel“. Thema der wissenschaftlichen 3sat-Sendung war „Projekt Strom“. Als Batterie-Experte beantwortete Fichtner zahlreiche Fragen zu zukünftigen Strom- und Energiespeichern und stellte innovative Methoden in der Batterieforschung vor.
Im Zentrum der Diskussion immer wieder die Rolle von Batterien in Elektroautos. Die oftmals in der Öffentlichkeit kritisierte Verwendung von Kobalt in Batterien ließ Fichtner nicht unkommentiert: „Die Forschung hat bereits früh antizipiert, wohin die Reise gehen kann. Eine Kurbelwelle eines Verbrennungsmotors wird im Jahre 2025 mehr Kobalt enthalten als die Batterie eines E-Autos.“ Die Debatte rund um die Nachteile der giftigen Kobalt-Förderung gehöre also bald der Geschichte an. Ebenso kursierten laut Fichtner immer noch zahlreiche weitere Mythen rund um Batterien. Vorstellungen zu „begrenzter Lebensdauer“ von Batterien entsprächen längst nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand.
Immer wieder räumte Fichtner mit allgemeinen Missverständnissen auf: „Es gibt keine Seltenen Erden in Batterien.“ Auch wenn die Förderung von Lithium nicht unproblematisch sei, müssten Rohstoff-Alternativen wie der Abbau und Verbrauch fossiler Energieträger immer in Relation zur Lithiumförderung gesehen werden. Ähnlich verhalte es sich mit dem vielzitierten Grundwasserverbrauch in der Atacama-Wüste – dem „Lithium-Dreieck“ zwischen Bolivien, Argentinien und Chile. Die dortige Lithium-Förderung stand immer wieder in der Kritik, da der Grundwasserspiegel in dieser Region stark absinkt. „Das Problem ist, der Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich seit den 1960er Jahren. Diese Absenkung ist allerdings nur teilweise dem Lithiumabbau zuzuordnen“, so Fichtner. Er führte aus, dass beispielsweise nahegelegene Kupferminen ebenso zu der Problematik beitrügen wie die Förderung von Lithiumvorkommen.
Erneuerbare Energien sind der Schlüssel zur #Energiewende, brauchen aber innovative Speichertechnologien. Über Möglichkeiten und Herausforderungen sprechen Maximilian Fichtner und Rafaela Hillerbrand vom KIT in der @3sat-Sendung #Scobel – Projekt Strom.https://t.co/qIQmRn5DhK pic.twitter.com/J7FL7R7ojb
— KIT Karlsruhe (@KITKarlsruhe) August 30, 2020
Die gesamte Sendung in der 3sat-Mediathek
https://www.3sat.de/wissen/scobel/scobel—projekt-strom-102.html
Beschreibung der Sendung vom 20.08.2020
„Da wird munter und erfolgreich an der Energiewende gearbeitet, weltweit wird gigawattweise Strom aus Sonnen- und Windkraft erzeugt. Doch die drängende Frage, wohin mit der ganzen Energie, bleibt unbeantwortet. Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen.Aus den Forschungslaboren dieser Welt hört man zwar regelmäßig von technologischen Durchbrüchen in der Entwicklung von Stromspeichersystemen. Schaut man aber genauer hin, sind dies meist nur Prototypen, die im Alltag nicht einsetzbar sind. Auch die Entwicklung von Stromspeichern für die boomende E-Mobilität kommt nicht wirklich voran. Die durchschnittlichen Kapazitäten von Batterien in E-Autos, aus der sich die mögliche Reichweite ergibt, sind immer noch bescheiden. Technologische Hürden können anscheinend nur schwer überwunden werden. Es braucht also dringend neue Ideen, neue Konzepte und technologische Innovationen für das Speichern von Energie.“
01.08.2020
Prof. Dr. Stefano Passerini, Dr. Dominic Bresser, Dr. Arianna Moretti und Dr. Alberto Varzi haben einen enzyklopädischen Leitfaden für gegenwärtige und zukünftige Batterietechnologien herausgegeben.
„Batteries – Present and Future Energy Storage Challenges“ ist ein umfassendes, zweibändiges Handbuch, das einen gegenwärtigen Überblick über die heute verwendeten Batterietechnologien bietet. Es enthält Informationen zu den geeigneten Materialien, die das Potenzial für eine weitere Verbesserung der Energie- und Leistungsdichten aufweisen. Die Publikation „Batteries“ ist Teil der „Encyclopedia of Electrochemistry“ und enthält Beiträge eines renommierten Gremiums internationaler Experten auf dem Fachgebiet.
Upcoming release: „#Batteries – Present and Future #Energy Storage Challenges“. Prof. Passerini, D. Bresser, A. Moretti and A. Varzi are publishing comprehensive, twovolume handbook. It offers an in-depth review of battery technologies in use today. ??https://t.co/Yj8TQqaZpV pic.twitter.com/qdQvPslOFZ
— Helmholtz Institute Ulm (@HelmholtzUlm) May 12, 2020
Batterien sind im modernen Leben äußerst verbreitet. Sie versorgen Autos, Flugzeuge, elektronische Geräte und intelligente Stromnetze mit elektrochemisch gespeicherter Energie in Form von Elektrizität. Die Publikation „Batteries“ enthält Informationen zu etablierten Batterietechnologien wie Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien auf der Basis von Ladungsträgern. Die Autoren untersuchen aktuelle Entwicklungen bei neuen Technologien wie Lithium-Schwefel- und Sauerstoff-, Natriumionen- und organischen Vollbatterien. Diese Fachpublikation:
– enthält Informationen zu den neuesten und aktuellsten Informationen zu Batterietechnologien sowie Gedanken zu zukünftigen Batterietechnologien;
– enthält Beiträge namhafter Fachleute;
– bietet einen zugänglichen Leitfaden für Neueinsteiger auf dem Gebiet der elektrochemischen Speicherung und dient als gut strukturierte Zusammenfassung für diejenigen, die bereits auf diesem Gebiet tätig sind.
„Batteries“ wurde für Elektrochemiker, physikalische Chemiker und Materialwissenschaftler geschrieben und ist ein zugängliches Kompendium, das einen gründlichen Überblick über die wichtigsten aktuellen Batterietechnologien bietet und die Technologie in den kommenden Jahren untersucht.
ISBN: 978-3-527-34576-2
Reihe: „Encyclopedia of Electrochemistry“
Hardcover: 900 Seiten
Verlag: WILEY VCH; 1. und 2. Auflage (August 2020)
Sprache: Englisch
Stefano Passerini ist Direktor am Helmholtz-Institut Ulm, Professor am Karlsruher Institut für Technologie und Gruppenleiter der Forschergruppe Electrochemistry for Batteries.
Dominic Bresser ist Gruppenleiter der Forschergruppe Electrochemical Energy Storage Materials am Helmholtz-Institut Ulm.
Arianna Moretti war leitende Wissenschaftlerin am Helmholtz-Institut Ulm für elektrochemische Energiespeicherung am Karlsruher Institut für Technologie.
Alberto Varzi ist Gruppenleiter der Forschergruppe „Electrochemistry of Materials and Interfaces“ am Helmholtz-Institut Ulm.